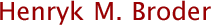Sie haben das Recht zu schweigen. Henryk M. Broders Sparring-Arena
02.10.2009 10:48 +Feedback
Im Kaufhaus des Ostens
Es war vor etwa zehn Jahren, ich hatte einen Flug von Berlin nach München gebucht. Einen ganz normalen Inlandsflug, bei dem man etwa 45 Minuten vor Abflug einchecken muss. Ich hatte mein Gepäck schon abgegeben und meine Bordkarte in der Hand.
Es ging langsamer als sonst voran, und die Verzögerung hatte einen Grund. Die Bundespolizei kontrollierte die Ausweise der Reisenden. Als West-Berlin noch „eine besondere politische Einheit“ war, die von den Alliierten überwacht wurde, war das die übliche Prozedur. Aber seit der Vereinigung waren die Ausweiskontrollen auf den Flügen von uns nach Berlin abgeschafft. Als ich an der Reihe war, fragte ich den Beamten, warum er meinen Pass sehen wollte. Ohne aufzublicken, antwortete er: „Das ist eine ganz normale Sonderkontrolle.“ Er meinte es weder böse noch ironisch, es war so: eine ganz normale Sonderkontrolle. Seitdem fällt mir der Satz des Grenzschützers immer dann ein, wenn ich mir etwas nicht erklären kann, das einerseits vollkommen normal und andererseits recht sonderbar ist.
Vor 20 Jahren waren nur wenige Deutsche bereit, sich über den Fall der Mauer und das Ende des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden zu freuen. Die meisten hatten sich mit der Existenz der DDR abgefunden. Für die Rechten war die DDR eine Pufferzone zwischen der freien Welt und dem Reich des Bösen, ein Stück Inland unter fremder Verwaltung, das darauf wartete, in ferner Zukunft heimgeholt zu werden.
Noch wichtiger freilich war die Erhaltung des Status quo. Deswegen wurde die DDR von der BRD mit Krediten und Subsidien am Leben erhalten. Für jeden politischen Gefangenen, der in die BRD ausreisen durfte, zahlte die Regierung der BRD etwa 90.000 DM an die Regierung der DDR. Was wie eine humanitäre Geste aussah, war ein Anreiz für die Staatssicherheit der DDR, möglichst viele „Dissidenten“ zu verhaften, um sie an die BRD „verkaufen“ zu können. Ohne die materielle Unterstützung aus dem Westen wäre die DDR möglicherweise eher kollabiert.
Für die Linken dagegen war die DDR ein Stück Ausland, in dem Deutsch gesprochen wurde, der andere, der bessere deutsche Staat, in dem vieles noch unvollkommen, aber das Wichtigste erreicht war – die Abschaffung der Herrschaft des Kapitals zugunsten der Diktatur des Proletariats. Dass in der DDR noch viel mehr abgeschafft war – die Meinungsfreiheit, die Reisefreiheit, die Idee der individuellen Verantwortung, freie Wahlen, eine unabhängige Justiz – störte sie wenig, weil sie nicht in der DDR leben mussten. Aus sicherer Distanz verfolgten sie ein Experiment, dessen plötzlicher Abbruch sie mit Zorn und Trauer erfüllte.
Günter Grass nannte die deutsche Teilung eine „Strafe für Auschwitz“, die auch über 44 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch nicht verbüßt wäre; der Dichter Stefan Heym, der in der DDR zu den privilegierten Dissidenten gehörte, die von der Regierung zugleich hofiert und überwacht wurden, zeigte sich angewidert vom Verhalten seiner ostdeutschen Landsleute, die die Grenzöffnung dazu nutzen, in den Westen zum Shoppen zu fahren. Heym selbst war noch zu DDR-Zeiten öfter zu Gast im „Kaufhaus des Westens“, wo er all die Artikel kaufen konnte, die in der DDR nicht zu haben waren. Sein US-Pass erlaubte es ihm, jederzeit von Grünau im Südosten von Ost-Berlin, wo er lebte, nach West-Berlin zu fahren, wo man ihn im KaDeWe als Kunden und schräg gegenüber, im Cafe Kranzler, als unangepassten Literaten schätzte.
Einerseits ist noch nie ein Staat so geordnet untergegangen wie die DDR, andererseits hat sich noch nie ein geteiltes Land so schwer getan, nach dem Ende der Teilung seine Identität zu finden. Was die Polen nach drei Teilungen und einer über 100 Jahre langen Zeit als „verschwundene Nation“ schafften, das scheint die Deutschen, unter viel besseren Bedingungen, politisch und emotional nach nur 40 Jahren zu überfordern.
Trotz der Milliarden, die jährlich in den „Wiederaufbau Ost“ investiert werden, fühlen sich die Bürger der ehemaligen DDR stärker diskriminiert als je zuvor. Bereits 1999, zehn Jahre nach dem Fall der Mauer, ergab eine Umfrage, dass Ost- und Westdeutschland immer weiter auseinanderdriften. „Die Ostdeutschen fühlen sich … mehr denn je als Menschen zweiter Klasse und reagieren wie in der DDR mit einem Rückzug ins Private.“ Erneut zehn Jahre später, 2009, ist das Gefühl noch ausgeprägter. 49 Prozent der Ostdeutschen stimmen dem Satz zu: „Die DDR hatte mehr gute als schlechte Seiten. Es gab ein paar Probleme, aber man konnte dort gut leben.“ Weitere acht Prozent meinen: „Die DDR hatte ganz überwiegend gute Seiten. Man lebte dort glücklicher und besser als heute im wiedervereinigten Deutschland.“ Zusammen macht das eine solide Mehrheit von 57 Prozent der Ostdeutschen, die sich nicht mehr daran erinnern mögen, dass der Anstoß zur Wiedervereinigung vom Osten und nicht vom Westen ausging, dass sie es waren, die für die deutsche Einheit auf die Straße gingen und riefen: „Helmut (Kohl) nimm uns an die Hand, zeig uns den Weg ins Wirtschaftswunderland!“
Heute sieht es danach aus, als würden sie sich und den Westdeutschen übel nehmen, dass sie tatsächlich an die Hand genommen und ins Wirtschaftswunderland geführt wurden. Sie agieren wie trotzige Kinder, die sich beweisen wollen, dass sie ihre Eltern nicht brauchen – aber erst nachdem sie eine Playstation, eine Stereoanlage, einen Computer und einen iPod bekommen haben.
Zugleich wird in der ganzen Republik immer wieder darüber gestritten, ob die DDR ein „Unrechtsstaat“ war. Sie sei weder ein „Rechtsstaat“ noch ein „Unrechtsstaat“ gewesen, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der postkommunistischen Linkspartei im Bundestag, Bodo Ramelow, noch im Februar 2009. Der Begriff „Unrechtsstaat“ verletze das Empfinden der Ostdeutschen. „16 Millionen ehemaligen DDR- Bürgern heute zu sagen, sie hätten in einem Unrechtsstaat gelebt, heißt, diesen Menschen ihre Erinnerung umzudeuten.“
Würde irgendein Politiker behaupten, der Begriff „Unrechtsstaat“ verletze die Gefühle derjenigen Deutschen, die im „Dritten Reich“ gelebt hätten, würde man ihn für bedingt zurechnungsfähig erklären. Im Falle der Linkspartei und ihrer Politiker liegen die Dinge anders. Denn die Partei, die in der DDR das Sagen hatte, ist inzwischen in 12 der 16 Länderparlamente vertreten, sie regiert in Berlin in einer Koalition zusammen mit der SPD und hat bei den letzten Landtagswahlen im Saarland 21 Prozent der Stimmen erhalten. Sie ist also eine politische Kraft, mit der gerechnet werden muss.
Die Rückkehr der Postkommunisten in die politische Arena ist ein Lehrstück, wie man durch geschicktes Taktieren und Koalieren ein als unmöglich geltendes Comeback schafft. Zuerst einmal durch mehrfachen Namenswechsel, um die Herkunft zu vernebeln. Aus der Staatspartei SED wurde die PDS, aus der Vereinigung der PDS mit einer Gruppe frustrierter Gewerkschafter und Sozialdemokraten in den alten Bundesländern entstand dann die Linke. Ein programmatischer Name, der eher an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert als an Erich Mielke und Erich Honecker. War die Linke zuerst isoliert, weil niemand mit ihr koalieren wollte, so kam es doch recht bald zu Bündnissen auf kommunaler Ebene. Das sei politisch bedeutungslos, hieß es; in Limbach-Oberfrohna, Callenberg, Viernau, Waldenburg und anderen Gemeinden auf dem Lande gehe es nicht um große Politik, sondern um Müllabfuhr, Kindergärten und Fahrradwege. Da könnten die Postkommunisten ruhig mitreden. Zudem sei es eine gute Methode, sie wieder in den politischen Prozess einzubinden.
Das klappte so gut, dass es bald zu formellen und informellen Koalitionen auf Länderebene kam, in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg- Vorpommern und Berlin. Damit waren die Postkommunisten rehabilitiert. Um ihren Vormarsch zu stoppen, machte der damalige Unions-Fraktionsvorsitzende, Friedrich Merz, Ende 2001 den Vorschlag, „Ländern mit Regierungsbeteiligung der PDS die Bundeszuschüsse zu kürzen“, und löste damit eine Welle der Empörung aus. Der Generalsekretär der SPD, Hubertus Heil, versicherte noch Mitte 2007, es werde im Westen der Bundesrepublik „keine Bündnisse der Sozialdemokraten mit der Linken geben“. Nach den letzten Wahlerfolgen der Linken wird man keinen Sozialdemokraten mehr finden, der glaubwürdig versichern könnte, es werde überhaupt keine Wahlbündnisse mit der Linken geben, wo auch immer. Auch eine Koalition der SPD mit der Linken im Bund gilt nicht mehr als ausgeschlossen.
So kommt es, dass sich mehr und mehr Bundesbürger fragen, wer im Jahre 1989 wen übernommen hat: die Bundesrepublik die DDR oder die DDR die Bundesrepublik? Denn die Verhältnisse in der Bundesrepublik gleichen sich immer mehr den Zuständen in der DDR an – natürlich auf einem ganz anderen wirtschaftlichen Niveau und mit einer immer noch gut funktionierenden Gewaltenteilung.
Auffällig ist vor allem die Verschiebung von Parametern, die die „inneren Werte“ einer Gesellschaft reflektieren: Freiheit und Gleichheit. Legten die Bürger der DDR vor der Wende vor allem Wert auf Gleichheit, war es bei den Westdeutschen die Freiheit.
Inzwischen finden sowohl Ostdeutsche wie Westdeutsche die soziale Gleichheit wichtiger als die Freiheit. Denn was nutzt einem schon die Freiheit, um die Welt fahren zu können, fragen sie, wenn man sich die teure Reise nicht leisten kann?
Ja, Deutschland ist schon ein ganz besonders normales Land. Gleichheit rangiert vor Freiheit. Reichtum ist für alle da. Muss aber kräftig besteuert werden, damit es keine sozialen Unterschiede gibt.
Zuerst erschienen im Tagesspiegel vom 02.10.2009