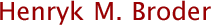Sie haben das Recht zu schweigen. Henryk M. Broders Sparring-Arena
09.09.2000 13:02 +Feedback
Fremde Federn: Wladimir Kaminer
Die Verdeckung Amerikas
Mit 16 dachten wir, alles Gute kommt aus Amerika, seien es Bücher, Klamotten, Musik. Wie die Papageien im Käfig redeten wir von Dingen, von denen wir keine Ahnung hatten. Was wussten wir von Amerika? Nichts. Das Magazin “Im Ausland” schilderte die USA als eine Gesellschaft, die sich auf der Macht des Geldes gründet und wo die kleinbürgerliche Moral als einzig denkbare gepriesen wird. Im Fernsehen kamen ab und zu Bilder von unterdrückten Werktätigen, die in den USA ein Bettlerdasein führen und ständig bis auf den letzten Pappkarton von den Kapitalisten ausgenommen werden. Regelmäßig konnte man auch das glückliche Gesicht von Dean Reed im Fernsehen sehen. Ihm war es gelungen, aus Amerika zu fliehen: Heilfroh sang er nun in der DDR “Guantanamera”. Wir glaubten dieser Propaganda nicht. Bestimmt waren die Penner aus dem Fernsehen extra von der Sowjetunion nach Amerika eingeflogen worden, um dort für die schrecklichen Bilder der Armut zu posieren. Dean Reed hielten wir für gekidnapped. Trotz seines ständigen Lächelns wirkten seine Augen traurig: Klar, er wollte zurück. Obwohl wir also von Amerika damals kein klares Bild hatten, genügte uns allein schon die Tatsache, dass irgendwo ein Land existierte, in dem alles anders als bei uns war, es zu lieben und zu verherrlichen. Im Nachhinein würde ich sagen: dieses “Amerika” war unsere Kindheit gewesen.

Mein Freund Goodwin, der schon mit vierzehn am Hotel Intourist mit Leninorden gedealt hatte, trieb im Sommer 1984 eine amerikanische Fahne auf: daraus nähte er sich ein Hemd - und aus dem Rest noch eine Mütze für mich. Diese Kleidungsstücke waren dann im November 84 einer der Gründe für unsere Verhaftung - nachdem wir mit ihnen am Smolenskij Boulevard, in der Nähe der amerikanischen Botschaft, aufgekreuzt waren. Ein älterer ermüdeter Major hörte sich zwei Stunden lang unser Gequatsche an. Er rauchte pausenlos und machte sich Notizen. Goodwin behauptete ihm gegenüber: Wir seien Kinder der amerikanischen Kultur und nicht der sowjetischen, deswegen verehrten wir die Farben der amerikanischen Fahne. Außerdem, so meinte mein Freund, wären wir in einem T-Shirt aus der sowjetischen Fahne noch schneller verhaftet worden.
“Na dann,” sagte der Major, “wenn Euch danach ist , braucht ihr die sowjetischen Pässe ja gar nicht, die ihr gerade bekommen habt.” Er schmiss unsere beiden nagelneuen Ausweise in den Mülleimer - und uns raus. Goodwins Freundin Diana hieß laut ihres Passes “Diana Amerikowna.” Auf so einen Namen waren alle neidisch. Daraus konnte man schließen, dass Dianas Vater den Namen “Amerikan” trug. Ihr Vater war aber ein ungarischer Kommunist gewesen, den Dianas Mutter irgendwann bei einem Gewerkschaftstreffen kennen gelernt hatte. Er war danach abgehauen. In Wirklichkeit hieß er Imre. Als Diana zur Welt kam, hatten sich die Beamte aus dem Standesamt etwas einfallen lassen und so wurde Diana als Amerikanowna in die Geburtsurkunde eingetragen.
Diana, Goodwin und ich gingen oft in die Schwimmhalle “Moskau” - der einzigen Badeanstalt unter freiem Himmel mitten in der Hauptstadt. Dort konnte man für dreißig Kopeken Eintritt unbeschwert auf einer Bank am Beckenrand sitzen, Wein trinken und den Menschen zugucken, wie sie sich in dem Brei bewegten. Die Schwimmhalle “Moskau” war nämlich die schmutzigste Badeanstalt der Stadt. Man konnte alles mögliche in ihren dunklen Gewässern finden. Sogar Amerikanern - d.h. wir lernten dort die ersten wahren Amerikaner kennen. Wir saßen friedlich auf einer Bank in unseren zerrissenen Klamotten, jeder hatte eine Flasche Rotwein der Marke “Kaukasus” in der Hand sowie eine Packung Schmelzkäse, der ganz volkstümlich einfach “Käse” hieß. Mit großem Interesse beobachteten wir an die uns vorbeischwimmenden Gegenstände. Plötzlich stieg ein Pärchen aus dem Wasser und kam zu uns: eine Frau mit goldblonden Haaren und einem sehr großen Hintern und ein Mann, der etwas unterernährt aussah. Sie stellten sich uns in gebrochenem Russisch vor - als Korrespondenten von CBS, die hier in Moskau einen Beitrag über sowjetische Jugendliche machen sollten. Und wir sahen genau so aus, wie sie sich die Moskauer Jugendlichen vorstellten. Ob wir nicht bereit wären, ein Interview zu geben? Na klar, sagten wir. Es war das Jahr 1985. Wäre einer von uns Student gewesen, dann hätte er dafür aus dem Institut rausfliegen können. Aber wir waren bereits rausgeflogen und hatten nichts mehr zu verlieren. Die Amerikaner verschwanden im Umkleideraum. Nach zwanzig Minuten kamen sie wieder und gaben uns fünf Rubel für ein Taxi.
“Wir treffen uns dann genau in einer Stunde vor dem Haupteingang des Hotels Intourist, sagten sie verschwörerisch zu uns und verließen schnell das Gelände. Das klang vielversprechend. Diana äußerte vorsichtig, dass ihrer Meinung nach amerikanische Journalisten anderes aussehen, und außerdem immer ihre Ausweise zeigen würden, bevor sie fremde Leute ansprachen, und schon gar nicht würden sie in das Becken der Badeanstalt “Moskau” einsteigen. Diana glaubte, dass es keine ausländischen Journalisten waren, die einen Beitrag über Moskauer Jugendliche machen wollten, sondern einheimische Pädophile, die sich an die besagte Jugend ranmachen wollten.
“Lass uns dieses Geld als Geschenk des Himmels betrachten und zwei neue Flaschen ‘Kaukasus’ dafür kaufen”, schlug Diana Amerikowna vor. Goodwin und ich empfanden jedoch eine gewisse Verantwortung für die Amerikaner und überredeten Diana, doch mit uns zum Hotel Intourist zu fahren, in der Hoffnung, das unsere neuen Freunde längst das Weite gesucht hatten.

Wir kamen viel zu spät. Doch die Amerikaner hielten sich an ihr Versprechen. Beide standen wie abgemacht vor der Tür und warteten geduldig mit einem Einlaßschein für uns. Wir hatten noch nie in ein solches Hotel von innen gesehen und schlüpften neugierig rein - an der Wache vorbei. In der Hotellobby befand sich ein kleiner Shop, in dem man für Dollars ausländische Produkte kaufen konnte.
“Habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr etwas essen oder trinken?” fragte der unterernährte Amerikaner etwas unüberlegt, als er unsere gierigen Blicke sah. Wir wollten natürlich beides. Von besonderem Interesse war für uns das amerikanische Dosenbier “Budweiser” sowie die leckeren Süßigkeiten - von denen der Laden voll war. Mit zwei Dutzend Büchsen und einer Packung Kekse gingen wir zur Kasse. Gegen das Bier hatte unserer Gastgeber nichts anzuwenden, aber die Kekse machten ihn auf einmal missmutig.
“Made in Südafrika!” sagte er und hielt die Packung mit zwei Fingern hoch, als ob es eine Kakerlake wäre. “Kein anständiger Mensch kauft Produkte aus diesem rassistischen Land. Für die Kekse muss die schwarze Bevölkerung bluten!” behauptete er.
“Ich würde sie trotzdem gern mal probieren, rein unpolitisch,” erwiderte Goodwin . Wir fuhren alle zusammen in den fünften Stock und kauften dort noch Menthol- Zigaretten der Marke “Salem” - auch ein Objekt der Begierde damals in Moskau. Zwei Stunden saßen wir dann bei den Amerikanern im Hotelzimmer, unterhielten uns und tranken “Bud”. Goodwin schwärmte von der amerikanischen Kultur, derer Söhne und Töchter wir angeblich wären, die UdSSR bezeichnete er dagegen als ein Imperium der Dummheit und der Barbarei. Ich wurde schnell ziemlich breit und unterstützte meinen Freund, indem ich ab und zu bedeutungsvoll den Kopf schüttelte und kicherte. Diana Amerikowna saß in der Ecke und fütterte ein kleines amerikanisches Bologneser-Hündchen mit den Keksen aus Südafrika. Dem schneeweißen Hund schmeckten die Apartheid-Kekse außerordentlich gut.
“Es war alles sehr interessant, was Sie uns hier erzählt haben,” sagte der amerikanische Journalist auf einmal, “aber jetzt müssen wir noch eine kleine Videoaufnahme von Ihnen machen - und fertig ist der Beitrag.” Er zwinkerte mit dem Auge, seine Kollegin bückte sich und zerrte unter dem Bett eine große Videokamera hervor.
Mein Freund Goodwin wehrte ab: “Nein,” sagte er, “das mach ich nicht mit, ich sehe heute einfach zu beschissen aus.” Auch Diana wollte sich partout nicht filmen lassen. Und ich kniff ebenfalls. Daraufhin entbrannte zwischen uns ein heftiges Gespräch mit gegenseitigen Vorwürfen. Nach langem hin und her musste Goodwin doch noch - als Hauptideologe unseres kleinen Trupps - vor der Kamera auftreten. Das waren wir den Amerikanern einfach schuldig. Immerhin hatten wir über zwei Stunden in ihrem Hotelzimmer gesessen, ihre Zigaretten geraucht und ihr Bier getrunken. Und das alles war extra für uns organisiert worden. Allein fürs Bier hatten sie zwanzig Dollar hingeblättert.
“Darf ich vor der Kamera sagen, was ich wirklich denke?” fragte Goodwin misstrauisch.
“Aber natürlich, nur zu!” freuten sich die Amerikaner. Goodwin drückte sich in einen der weichen Sessel, mit einer Dose “Bud” in der einen Hand und einer brennenden “Salem” in der anderen. Sein Gesicht bedeckte sich langsam mit roten Flecken. Mein Freund sah aus wie ein Doppelagent, der die ersten Interviews nach seiner Enttarnung gibt.
“Guten Tag,” sagte Goodwin mit ungewöhnlich hoher Stimme in die Kamera. “Ich heiße Mischa. Ich wohne hier. Ich liebe meine Heimat - die Sowjetunion und vor allem ihre Hauptstadt: die Heldenstadt Moskau. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.” Nach einer langen Pause fing der Amerikaner an, nervös zu lachen, seine Kollegin auch. Das Bologneser-Hündchen kotzte plötzlich auf den Teppich. Als wir aus dem Hotel rauskamen, war es schon sehr spät. Wir hatten die Straßenbahn für uns allein und bespöttelten Goodwin.
“Ich liebe die Heldenstadt Moskau! Das gibt’s doch nicht!” Dieser Satz wurde ihm noch lange nachgetragen. Alle unsere Bekannten wussten bald von der Geschichte im Hotel Intourist und fühlten sich verpflichtet, Goodwin immer wieder damit zu ärgern. Ende der Achtziger Jahren entdeckten wir Schritt für Schritt Amerika weiter. Es war enttäuschend. Der Käfig öffnete sich langsam und immer mehr Dinge kamen aus Amerika zu uns: Überall liefen nun amerikanische Filme - die meisten waren langweilig, die T-Shirts in den Farben der amerikanischen Fahne konnte man an jeder Ecke erwerben - aber sie verfärbten sich beim ersten Mal Waschen, und vor dem ersten McDonalds am Puschkin Platz bildete sich eine dreieinhalb Kilometer lange Schlange - sie hielt jedoch nicht einmal ein Jahr. Täglich wurde sie kürzer und kürzer bis sie eines Tages ganz verschwand. Amerika brach quasi vor unseren Augen zusammen. Diese Zeit war durch ein wachsendes Desinteresse an westlichen Symbolen gekennzeichnet. Das Lied “Good bye, America” von der russischen Cultband “Nautilus Pompilius” wurde damals zum Hit der Saison.
Es klang wie ein Abschied von der Kindheit, von der Sehnsucht nach einer noch besseren Welt: “Good bye America, Du!” sang der Solist mit trauriger Stimme: “Nimm dein Banjo und deine Jeans und hau ab. Aber warte, zum Abschied kannst Du mir noch ein letztes mal das Lied singen. Ein Lied über das Land meiner Träume, das mich verarschte, Du!”.

Ich war noch nie in Amerika, doch in den Neunzigern - der Zeit des allgemeinen Pendelverkehrs - lernte ich viele Amerikaner kennen, die aus ihrer Heimat geflüchtet waren und es sich nun in Berlin, Prag oder Moskau gemütlich zu machen versuchten. Ich nannte sie die Amerikaner im Exil - alles ganz unterschiedliche Leute. Das einzige, was sie gemeinsam hatten, war: Sie wollten alle keine Amerikaner sein - und versteckten ihre wahre Identität. Der eine arbeitete als Rausschmeißer in einer proletarischen Berliner Kneipe und erzählte jedem, der ihn nach seinem Akzent fragte, er sei aus Nord-Kanada abgehauen und wäre der jüngste Sohn einer Holzfällerdynastie. Solche Geschichten kommen bei den hiesigen Eingeborenen immer gut an: Sie verherrlichen alle die körperliche Arbeit - je länger sie arbeitslos sind, um so mehr. Doch in Wirklichkeit kam der Mann aus dem sonnigen Kalifornien und niemand in seiner Familie hatte je eine Motorsäge in der Hand gehabt. Der andere Amerikaner war Betreiber einen Feinkostladen in Mitte: “Spezialitäten aus der Provence”. Er rauchte Pfeife, trug Hemden aus Seide und sprach Deutsch mit einem leicht französischen Akzent. Gerne erzählte er von seiner Jugend in Marseille, er war aber ein hundertprozentiger Amerikaner aus Detroit. Auch unter den Studenten der Humboldt Universität konnte man Anfang der Neunziger Jahre viele Amerikaner finden. Sie studierten die skurrilsten Wissenschaften, Theologie oder Slawistik beispielsweise, und schienen mit sich und der Welt sehr zufrieden zu sein. Einer dieser Slawisten - namens John - verführte unsere ukrainische Freundin Lisa, die 1990 mit uns zusammen im Marzahner Ausländerheim wohnte und sich ebenfalls bei den Slawisten der Humboldt Universität eingeschrieben hatte. John konnte ganz gut russisch, weil er zwei Jahre lang in einer Abteilung der amerikanischen Armee gedient hatte, die direkt an der deutsch-deutschen Grenze unweit Magdeburgs stationiert gewesen war. Ihre Aufgabe war die Funküberwachung sowjetischer Truppen. Tag für Tag saß John mit Kopfhörern in einem gut getarnten Wagen und versuchte die Meldungen des russischen Militärs abzufangen: er schrieb alles auf, was er entziffern konnte, nicht nur die russischen Militärberichte, sondern auch die Unterhaltungsprogramme des Rundfunks der Sowjetischen Armee. Diese Programme bestanden zum größten Teil aus Musik und sollten die sowjetischen Soldaten bei der Erfüllung ihrer internationalen Pflicht in dem fernen Land ermutigen. Alle sowjetischen Einheiten, die entlang der deutsch-deutschen Grenze stationiert waren, hatten ihre Lieblingssängerinnen. Die Auswahl war damals nicht besonderes groß. Es sollten vor allem schöne Frauenstimmen sein, der Text und die Musik waren unwichtig.
Jedesmal bevor ein Lied gesendet wurde, erfolgte eine Ansage: “Und nun, liebe Kameraden, singt Schanna Bitschewskaja für die Soldaten unserer berühmten Division 17039 das Lied ‘Deine Heimat vergisst dich nie’”. Solche Sendungen waren für die Amerikaner von enormer Bedeutung. Nicht die Lieder selbst, sondern die Nummern der Einheiten sollte der Soldat John sorgfältig notieren. Wenn die Stimme der Sängerin Schanna zum Beispiel lange Zeit nicht zu hören war, dann bedeutete dies, dass die Einheit 17039 verlegt worden war. Auf diese Weise konnten die Amerikaner die Bewegungen der russischen Truppenteile nachvollziehen.
Als seine Dienstzeit zu Ende war, beschoss John noch eine Weile in Deutschland zu bleiben. In Amerika warteten eigentlich nur die Eltern auf ihn, die sein Schicksal fest in ihren Händen hielten. Er sollte Zahnarzt werden wie sein Vater. Nur in Deutschland konnte er noch selbstständige Entscheidungen treffen, und zum Beispiel Slawistik studieren. Außerdem waren die Amerikaner damals im Osten noch exotisch und sehr beliebt. Oft besuchte John, der selbst in einem Studentenheim am Ostbahnhof wohnte, unsere Lisa in Marzahn. Er schaute dann auch bei uns vorbei und führte endlose Diskussionen mit meinem Freund Andrej, der mit mir ein Zimmer teilte. Andrej war zur selben Zeit wie John in der Armee gewesen. Weil er gut Englisch konnte, wurde er als Funker bei der sogenannten “Westgruppe der sowjetischen Armee” in Deutschland eingesetzt und gerade vor Johns Nase stationiert. Soldat Andrej war für die Funküberwachung der Amerikaner zuständig. Seine Aufgabe bestand darin, alle amerikanischen Meldungen inklusive der Unterhaltungsprogramme abzufangen, und die Nummern der Einheiten sowie auch die dazugehörigen Songs aufzuschreiben. Zwei Jahre lang saß Andrej in einem gut getarnten Wagen mit Kopfhörern und Stift und lauschte.
Für die Amis sangen hauptsächlich die Männer: “Guten Morgen, Germany” sagte der Moderator, “heute singt Roger Daltrey - live aus Arizona - für unsere tapferen Spear-Heads der 78. Unit im Harz: ‘I can explode every minute’.” Die Gespräche zwischen den beiden Ex-Soldaten hörten sich für Außenstehende an wie Dialoge zwischen zwei Schwerkranken in einer Klapsmühle. Ich nannte ihre Begegnungen “Das Treffen an der Elbe II”. “Unit 322” sagte Andrej. Sofort sprangen beide vom Tisch auf und schrien : “She loves you yeah,yeah,yeah, She loves you yeah,yeah, yeah”
“80112” konterte John, woraufhin sofort: “Oh Rodina! Deine groooßen Felder, werde ich vermiiieeesen…” kam.
John, der anfänglich noch seine Heimat verherrlicht und die geopolitischen Interessen der USA uns gegenüber in der Küche verteidigte hatte, wurde mit der Zeit immer skeptischer. Er interessierte sich stattdessen immer mehr für die russische Literatur, konnte Dostojewski fast auswendig - und heiratete schließlich Lisa. Die beiden zogen zusammen - in eine Wohnung im Prenzlauer Berg. Lisa konnte jeden Tag nach altem ukrainischen Rezept eine dicke Suppe, von der John nicht genug kriegen konnte. Beide wurden schnell dick. Bald nahmen wir John nicht mehr als Amerikaner wahr. Einige seiner Landsleute hatten sich auch in Moskau eingenistet. 1999, als ich meine Schwester dort besuchte, lernte ich einige dieser Moskauer Amerikaner kennen. Mister Aims und Mister Teiby sind wahrscheinlich die berühmtesten unter ihnen. Sie geben in der russischen Hauptstadt eine englischsprachige Zeitung “The eXile” heraus, in dem sie oft und gerne unangenehme Dinge über ihre Heimat verbreiten. “The eXile” wird von den Westlern, die in Moskau leben und arbeiten - der eigentlichen Zielgruppe - gehasst.
Dafür wird sie mit Interesse von jungen Russen gelesen: “In Amerika fühlten wir uns ausgestoßen.” erklärten Aims und Teiby. “Ein Mensch, der einfach nur frei und glücklich leben will, hat in diesem Lügenimperium keine Chance. Das Leben in der USA ist ungenießbar. Alle amerikanischen Männer werden durch Fernsehen fremdgesteuert und alle amerikanischen Frauen haben dicke Ärsche, aber die Presse verschweigt es. Dafür darf der Amerikaner ständig in den ‘Penthouse Letters’ lesen, wie sexy das ‘American Life’ ist: Auf den Seiten dieses Magazins lernen ständig die Männer irgendwelche wildfremden Schönheiten in Bars und Restaurants kennen und machen mit ihnen dann Sex an unvorstellbaren Orten in kompliziertesten Stellungen. Den amerikanischen Lesern dieser Geschichten beschleicht dabei das blöde Gefühl, dass das Leben an ihnen vorbeirauscht. Die traurige Wahrheit aber ist: all diese Geschichten werden von Redakteuren ausgedacht und haben nichts mit der Realität zu tun. In Amerika kannst Du keine Frau in einer Bar anbaggern. Selbst bei einem schüchternen Versuch landest Du schnell vor Gericht und gut möglich sogar im Knast. Ganz anderes ist es dagegen hier in Russland. Wir bedanken uns deswegen für das humanitäre Asyl, das wir hier fanden,” schrieben Aims and Teiby in der letzten Ausgabe ihrer Zeitung.
Weiter annoncierten die beiden Amerikaner einen Wettbewerb: “Would You Like To Fuck President Clinton?” - an dem sich schließlich über 200 Mädchen aus der Provinz beteiligten. Außerdem veröffentlichten sie ein Buch: “Sex, Drugs, and Life in the New Russia.” in dem die beiden ihre Exilerfahrungen ausbreiteten. Durch diese beiden Amis entsteht langsam ein neues Bild von Amerika bei meinen Landsleuten, zumindest bei denen, die Englisch lesen. Gott segne die unvermeidliche Logik der Natur: für jeden Arsch findet sich immer eine passende Hose, für jede Hütte ein Onkel Tom und für jeden ausgestoßenen Amerikaner ein neues Zuhause. Inzwischen sind Aims und Teiby absolut russifiziert. Sie können literweise Wodka saufen, zwei Kilo Hühnerschenkel auf einmal verspeisen und ihren Urlaub verbringen sie natürlich auf der Krim. “Ach, die Krim, da würde ich auch gerne mal hin,” sagte ich zu meiner Schwester, als wir auf dem Smolensky-Boulevard spazieren gingen.



Wladimir Kaminer
wladimir kaminer, 1967 in moskau geboren, lebt seit 199o in der hauptstadt. er schreibt wunderbare kurzgeschichten aus dem alltag, die jetzt als buch erschienen sind: russendisko, manhattan verlag. fotos von sabine sauer (der spiegel)
9.9.2000